Der Islamwissenschaftler und Religionsphilosoph Ahmad Milad Karimi stellt hier die Frage, inwiefern das Mensch-Maschine-Verhältnis den Gottesbezug des Menschen beeinflusst und inwieweit wir mit der KI-Entwicklung daran arbeiten einen neuen Gott 2.0 zu erschaffen. Karimi kritisiert das trans- und posthumanistische Ziel den Menschen mithilfe von Technologie zu perfektionieren oder gar zu überwinden und charakterisiert es als anti-humanistisch.
Der programmierten Perfektion des homo digitalis, stellt er den homo poeticus gegenüber, mit all seinen Macken, Einschränkungen und Unzulänglichkeiten. Dabei lobt Karimi die Fehlbarkeit des Menschen als charakteristische, wichtige und wertzuschätzende Eigenschaft, denn “Fehlbarkeit gibt Raum für Kreativität, Fragmentierung und Unvollkommenheit.” (S. 11) Eine Theologie im Zeitalter aalglatter, lupenreiner, optimierter Benutzeroberflächen sei “dazu aufgerufen, den imperfekten Menschen zu würdigen.” (S. 12) Karimi entwirft eine Theologie der Imperfektibilität, die im Gegensatz steht zu der Techno-Theologie der Silicon Valley.
Außerdem vergleicht Karimi den Versuch eine allwissende, omnipräsente KI zu erschaffen mit der Vorstellung des omnipotenten Gottes der abrahamitischen Religionen. Aber während der alte Gott 1.0 eine wirklich transzendente Erfahrung ermöglicht, handelt es sich beim Gott 2.0 nur um eine scheinbar gottähnliche Entität, die letztendlich nur ein Spiegel menschlicher Ambitionen ist.
“Der Unterschied zwischen einem Gott 2.0 und dem abrahamitisch-monotheistischen Gott besteht darin, dass [… der] Gott der Religionen für seine Verbindlichkeit, seine Gerechtigkeit, seine Treue, seine Liebe und seine Barmherzigkeit wirbt.” (S. 79)
“Jedoch lässt Gott 2.0 einer singulären vollkommenen Intelligenz weder auf Liebe noch auf Barmherzigkeit oder Treue schließen. Seine Attribute lassen sich allein als Attribute der Vollkommenheit erahnen […] wie etwa völlige Berechenbarkeit, maximale Effizienz, Allmacht oder Allwissenheit.” (S. 80)
Die größte Schwäche in Karimis Auseinandersetzung mit KI liegt darin, dass aktuelle technische Entwicklungen keine Rolle spielen, sondern er von einer zukünftigen superintelligenten KI ausgeht, die dem Anspruch der Perfektion zu mindestens Nahe kommen kann. Seine Überlegungen scheinen sich daher eher auf Maschinen aus dem Science-Fiction Universum zu beziehen als auf ChatGPT. Das liegt auch daran, dass er sich intensiv mit Post- und Transhumanismus beschäftigt, zwei Bewegungen, die aktuell noch in den Kinderschuhen stecken. Trotzdem ist es spannend, Karimis theologische Perspektive auf das KI-Thema kennenzulernen!
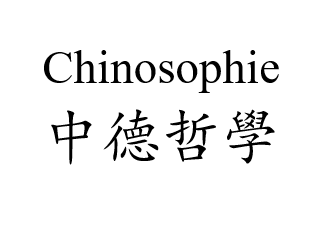
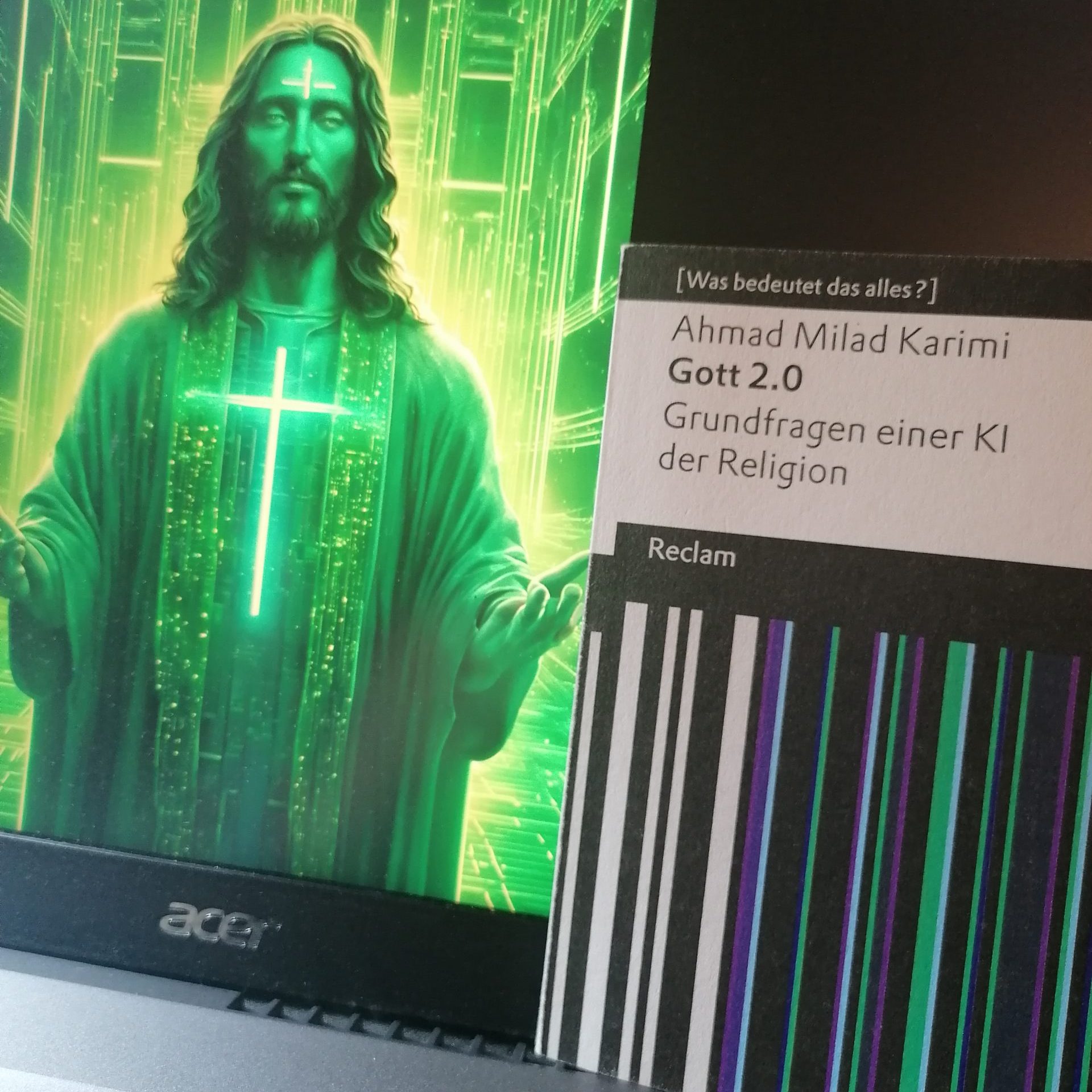
Schreibe einen Kommentar